
Egal ob Riesen-Oktopusse, ein sprechender Kater, ein nachtaktives Mädchen mit Eulenblick oder scheindemokratische Tierversammlungen, ein Baby-Mammut und ein Traumfresser: Die Helden der Freizeit präsentieren dir 14 affenstarke Tier-Romane, die du so leicht nicht aus der Hand legen wirst – höchstens, um mal kurz das Katzenfutter zu servieren.
von Christina H. Janousek, 17. 11. 2025
Die Faszination mit Tieren ist ungebrochen. Sie sind Gefährten und Versuchsobjekte, Projektionsflächen und Mahner, Stoff für Märchen und Symbol ökologischer Rebellion zugleich. Mal dienen sie der Unterhaltung, mal der Erkenntnis – und manchmal halten sie uns schlicht den Spiegel vor.
14 Tierbuch-Tipps von Christina
T. C. Boyle: Talk to Me (Bloomsbury)
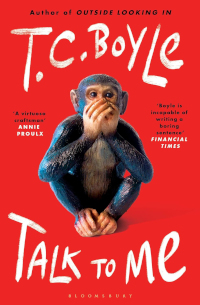
Der Psychologe Guy Schermerhorn, Dozent an einer kalifornischen Universität, will dem Schimpansen Sam die amerikanische Zeichensprache beibringen. Doch Sam ist kein lehrbuchhafter Versuchskandidat. Er wird zum Medienstar, zur Sensation in Talkshows – und hinter den Kulissen zum Opfer fragwürdiger Disziplinarmaßnahmen.
Auch die junge Studentin Aimee beginnt zu zweifeln. Das Experiment, das sich als Fortschritt der Forschung ausgibt, lebt in Wahrheit vom Glanz öffentlicher Aufmerksamkeit und den Verlockungen des Geldes. Sam, längst zum Ersatzkind von Guy und Aimee geworden, zeigt Stimmungsschwankungen, Trennungsängste und Aggressionen. Als die Fördergelder versiegen, bröckelt die Fassade wissenschaftlicher Seriosität – und alle Beteiligten offenbaren ihre wahren Motive.
Mit Talk to Me greift T. C. Boyle eine historische Debatte der Primatologie auf: Kann ein Affe eine menschliche Sprache erlernen, wenn ihm zugleich sein eigenes soziales Gefüge entzogen wird? Inspiriert vom Fall des Schimpansen Noa Chimpsky zeichnet Boyle das Porträt eines Forschungsprojekts, das an den Grenzen von Ethik, Eitelkeit und Erkenntnis scheitert. In der Tradition von Kafkas Bericht für eine Akademie stellt er die Frage neu: Wer ist hier eigentlich der Mensch – der Affe oder seine Betreuer? Ein Roman als brillante, provokante Parabel über Macht, Mitleid und die Hybris der Wissenschaft.
Ray Nayler: The Mountain in the Sea (Weidenfeld & Nicolson)
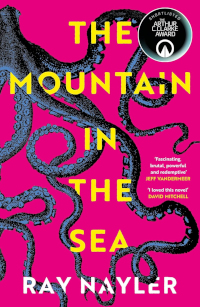
Die Meeresbiologin Dr. Ha Nguyen wird von der KI-Firma Dianima auf den vietnamesischen Archipel Côn Đảo eingeladen, um dort das Verhalten von Oktopussen zu erforschen. An ihrer Seite: der Androide Evrim und die Cyborg-Sicherheitschefin Altantsetseg. Gemeinsam versuchen sie, das Geheimnis zu lüften, das in den Tiefen vor der Küste verborgen liegt – und das Dianima um jeden Preis schützen will. Denn die Firma hütet die Insel wie ihren eigenen Augapfel: Eindringlinge zahlen mit dem Leben. Niemand darf erfahren, dass die genetische Struktur und das Kommunikationsverhalten der Kopffüßer den Schlüssel zu einer bahnbrechenden Erfindung bergen – einer künstlichen Intelligenz mit menschlichen Zügen und einem totalen, fehlerfreien Gedächtnis.
Ray Naylers The Mountain in the Sea ist ein ungewöhnlich reflektierter Science-Fiction-Roman – über die Angst, das eigene Spiegelbild in einer fremden Spezies zu erkennen, und über die Möglichkeit, die Kluft zwischen Mensch, Tier und Maschine zu überbrücken. Auch über das einzigartige Nervensystem der Kopffüßer wird man hier schlau: Verlieren sie einen Tentakel, bleibt er sensibel und mobil. Das Zusammenspiel von zentraler und peripherer Steuerung wird zum Sinnbild für Fragen nach Bewusstsein und freiem Willen – auch in Bezug auf Künstliche Intelligenz. So verbindet Nayler naturwissenschaftliche Präzision mit philosophischer Tiefe und schreibt zugleich ein Plädoyer gegen den Größenwahn der Forschung. Ein Roman, von dem sich Wells, Lovecraft und King ein Stück abschneiden können.
Ruth Kornberger: Die Spur der Bambusbären (C. Bertelsmann)
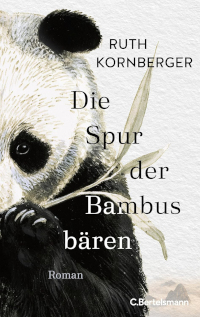
Ihren historischen Roman Die Spur der Bambusbären widmet Ruth Kornberger einer Frau, die sich über die Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzte: der New Yorker Modedesignerin Ruth Harkness. Kaum hat sie mit dem Tod ihres Mannes abgeschlossen, übernimmt sie 1936 sein waghalsiges Vorhaben, die ersten lebenden Pandas aus Tibet in die USA zu bringen – allerdings nicht als ausgestopfte Jagdtrophäen, sondern als Forschungsobjekte für zoologische Studien. Harkness, die sich mit einem Tross aus Expeditionisten, Wissenschaftlern und einem Fotografen in unbekanntes Terrain aufmacht, sieht sich bald mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert.
Kornberger schildert eindrucksvoll, wie die Pandas zum politischen Spielball zweier Nationen gerieten und welchen physischen wie seelischen Preis Harkness bereit war zu zahlen, um das Vermächtnis ihres Mannes zu ehren. Harkness erscheint weder als sentimental verklärte Tiermutter noch als reine Idealistin. Dass Harkness damit dennoch einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Pandas leistete, vermittelt Kornbergers Roman mit leichter Hand.
Nick McDonell: The Council of Animals (Henry Holt and Co)
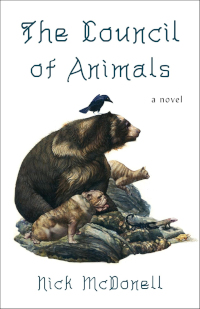
Wir schreiben ein postapokalyptisches Zeitalter. Tiere beherrschen die Geheimsprache grak und befinden in einer Versammlung über das Schicksal der letzten Menschen. Nach einer vom Menschen selbst verschuldeten Katastrophe, die Tier- und Pflanzenmutationen sowie andere Umweltschäden verursacht hat und nach der sich z. B. eine Rieseneidechse für eine Fledermaus hält, ist die Spezies Mensch auf eine Handvoll Überlebender geschrumpft – und damit auf die Gnade der Tiere angewiesen. Die Frage, über die abgestimmt wird, ist von archaischer Schlichtheit und brutaler Konsequenz: die Menschen am Leben lassen oder töten?
Dass George Orwells Animal Farm über Nick McDonells Council of Animals seine Schatten wirft, ist kaum zu verhehlen. Doch McDonell hat die Klugheit, nicht noch einmal die alte Parabel vom Verrat der Revolution zu erzählen. Seine Tiere sind keine Marx-, Stalin- oder Hitler-Karikaturen im Fellkostüm, keine Ideologen auf vier Beinen. Sie sprechen für sich, ohne sich dabei in Menschengestalten zu verwandeln – und gerade in dieser Distanz liegt der Reiz. Hier entsteht keine politische Satire, die historische Begebenheiten durch den Kakao zieht. McDonell entwirft vielmehr eine Gegenform der Geschichtsschreibung. Eine, die sich auf Tiermythen stützt, dabei aber weder in Utopismus noch in Parabelhaftigkeit verharrt.
Gabrielle Filteau-Chiba: Die Ungezähmten (dtv)
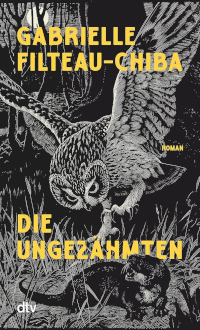
Die Wildhüterin Raphaelle Robichaud hat ihr Leben einer Mission verschrieben: die Tiere in der kanadischen Gemeinde Kamouraska vor Wilderern zu schützen. Zu oft hat sie mitansehen müssen, wie halbherzig gegen illegale Jagden vorgegangen wurde, wie selten ernsthafte Maßnahmen zur Bewahrung der Artenvielfalt ergriffen und wie leichtfertig Jagdquoten für Luchse vergeben wurden. Doch um der erdrückenden Einsamkeit zu trotzen, nimmt sich Raphaelle eine ungewöhnliche Gefährtin an die Seite: eine Kojotin. Als ausgerechnet ihre tierische Freundin in die Falle des berüchtigtsten Wilderers Kamouraskas gerät, steht Raphaelle plötzlich an einem Scheideweg. Von nun an gilt es, nicht nur ihre tierische Begleiterin, sondern ihr eigenes Leben und das der Wildtiere zu verteidigen.
Mit Die Ungezähmten legt Gabrielle Filteau-Chiba einen emotional aufgeladenen, ökofeministischen Survival-Thriller vor. Sie erzählt von der Dringlichkeit, den Stimmlosen – den wilden Tieren – ein Echo des Widerstands zu verleihen, gerade dann, wenn alle anderen wegschauen. Es ist ein Roman über Zivilcourage, über Freiheit und inneren Frieden, der nur im Einklang mit der Natur entstehen kann.
Yamen Manai: The Ardent Swarm (Amazon Crossing)
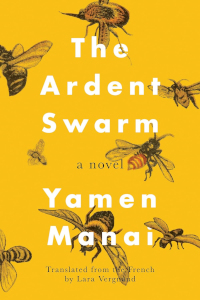
In einem fiktiven nordafrikanischen Dorf widmet sich der Imker Sidi mit hingebungsvoller Ruhe seinen Bienenstöcken. Als er eines Tages mehr als die Hälfte seiner Kolonie tot vorfindet, steht nicht nur seine Existenz, sondern das Überleben des ganzen Dorfes auf dem Spiel. Zugleich erhebt der Kronprinz des fiktiven Erdölstaates Quafar Besitzanspruch auf die Region – ahnungslos, dass ein Schiff aus seinem Land das Nest einer tödlichen Hornissenart eingeschleppt hat. Sidi erkennt: Nur wenn er selbst in den Kreislauf der Natur eingreift, kann er das ökologische Gleichgewicht – und vielleicht auch den Frieden – bewahren.
Yamen Manaïs The Ardent Swarm erzählt von diesem Kampf zwischen Bienen und Hornissen als Parabel auf die politischen Umbrüche Tunesiens während des Arabischen Frühlings – und auf die Spannungen, die den gesamten arabischen Raum erfassten. Zugleich öffnet der Roman den Blick in die Ordnung des Bienenstaats – ein Miniaturmodell fundamentalistischer Macht? Mit scharfem Blick beschreibt Manaï, wie Sidi gezwungen wird, seine Bienen zu opfern, um die Dekadenz der Mächtigen zu nähren, und wie selbst religiöser Eifer zur Farce wird.
Helene Bockhorst: Der Supergaul – Kein Pferderoman (Ullstein)
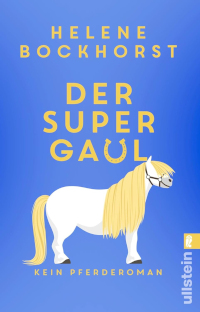
Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht . Dieser Satz wird für Berenice – eine selbstproklamierte ‚Tierkommunikatorin‘, die ihren leichtgläubigen Kunden skrupellos das Geld aus der Tasche zieht – zur bitterbösen Wahrheit. Denn ausgerechnet diese Scharlatanin trifft nun wirklich auf das unmögliche Phänomen: ein sprechendes Shetland-Pony namens Alvin, das an ihre Hilfe appelliert: Berenice soll das verschollene Rennpferd Rennbrandt aufspüren.
Dieser abgrundtief witzige Roman zieht nicht nur Pferdeliebhaber in seinen Bann. Er ist auch ein Lese-Schmankerl für alle, die das pathologische Flunkern lieber durch die ironische Lupe der Unterhaltung betrachten wollen. Liebe, Lust, Tragikomik und detektivisches Gespür würzen die Handlung ebenso wie Bockhorsts Zynismus. Da rammeln Hengste, die Heldin hält eine Trauerrede auf ein Pferd und ein flambierter Hummer verwandelt ein Restaurant beinahe in ein Flammenmeer. Selbst die Schrullen der Pferdewetter bekommen ihr Fett weg – und machen Der Supergaul zu einer unterhaltsamen Lektüre, die man mit einem Grinsen aus der Hand legt.
Jochen Gutsch, Maxim Leo: Frankie (Penguin Verlag)
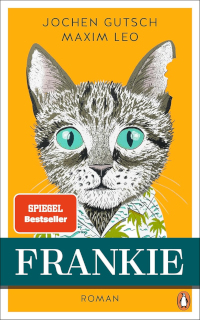
Wer regelmäßig auf TikTok scrollt, ist spätestens seit Ende 2022 über das cat distribution system (Katzenverteilungssystem) gestolpert. Eine skurrile Theorie, derzufolge eine unsichtbare Macht Mensch und Katze genau dann zusammenführt, wenn Ersterer am dringendsten auf die samtpfotige Begleitung angewiesen ist.
Kein anderer Roman greift diesen Gedanken so charmant auf wie Frankie, der internationale Bestseller von Jochen Gutsch und Maxim Leo. Im Mittelpunkt steht der titelgebende Kater Frankie, aus dessen Perspektive erzählt wird. Frankie taucht im entscheidenden Moment im Leben von Richard Gold auf. Gold, von Depressionen nach dem frühen Tod seiner Frau gezeichnet, findet mithilfe des sprechenden Katers Schritt für Schritt zurück ins Leben. Und schafft es umgekehrt in einem Moment, in dem Frankies Schicksal am seidenen Faden hängt, für seinen neuen Freund da zu sein. Die Autoren balancieren dabei geschickt zwischen Leichtigkeit und Tiefgang. Während Frankie über Liebe, Logik und menschliche Absurditäten philosophiert, blitzt hinter dem Humor stets die Tragik des Daseins hervor. So wird aus einer Geschichte über einen ungewöhnlichen Vierbeiner ein kluges, warmherziges Buch.
Ingrid Noll: Nachteule (Diogenes)
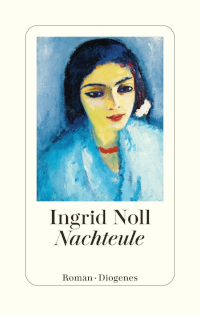
Die 15-jährige Luisa fühlt sich seit jeher mehr zu Tieren hingezogen als zu Menschen. Die aus Peru adoptierte Einzelgängerin studiert lieber Tierlaute, streift mit Katzen umher oder beobachtet Füchse im Garten, statt sich mit Gleichaltrigen zu treffen. Und sie trägt ein Geheimnis in sich: Luisa kann im Dunkeln sehen – wie eine Eule. Davon wissen nur ihre Adoptiveltern und Tim, ein Fremder, der eines Nachts unerwartet in ihrem Haus auftaucht. Doch Tim ist nicht, wer er zu sein scheint – und mit ihm treten auch in Luisas Familie Schatten zutage.
In Nachteule verbindet Ingrid Noll Coming-of-Age-, Kriminal- und Phantastik-Elemente zu einer feinen, schwebenden Erzählung. Das Übersinnliche bleibt unaufgelöst – Luisas Gabe wird weder erklärt noch hinterfragt. Noll interessiert weniger die Wissenschaft als die Übergänge: jener fragile Raum, in dem der Mensch weder ganz Natur noch ganz Kultur ist. Mit leiser Ironie und Empathie fragt sie, was es heißt, sich selbst treu zu bleiben – und die eigene Natur nicht zu verraten.
Simone Hirth: Die Kröte (Kremayr & Scheriau)
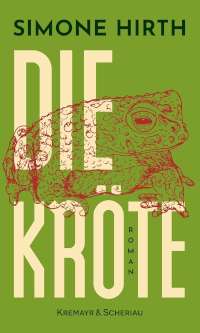
Stell dir vor, du lässt dein Handy ins Wasser fallen – und eine Kröte bietet an, es herauszufischen. Verstörend ist weniger, dass sie spricht, sondern wie sie spricht: launisch, spöttisch, unberechenbar. Sie legt jedes Wort auf die Waagschale, verdreht Argumente, unterwandert jede Gewissheit. Wer von ihr erzählt, gilt bald als unzurechnungsfähig.
So ergeht es Milena, der Ich-Erzählerin, die ihre Begegnungen mit der Kröte verzweifelt festzuhalten versucht – und doch von ihr vereinnahmt wird. Selbst die Erzählung gerät unter ihren Einfluss: Die Kröte kommentiert, widerspricht, schreibt mit. Simone Hirths Die Kröte ist ein philosophisches Spiel mit Fabel, Allegorie und Märchen, durchzogen vom Geist Kafkas. Gut und Böse lösen sich auf, Ironie und Empathie verschränken sich. Die Kröte provoziert – und zwingt Milena (und die Lesenden), über Wahrheit, Wahrnehmung und Manipulation im postfaktischen Zeitalter nachzudenken. Ein kluges, komisches und beunruhigendes Gedankenexperiment.
Paul Ruban: Der Duft des Wals (aufbau)
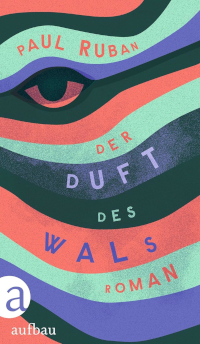
Für das Ehepaar Judith und Hugo, das während eines Mexikoaufenthalts den Funken einer längst erloschenen Liebe erneut entfachen möchte, gibt es keinen größeren Stimmungskiller als den hartnäckigen Verwesungsgeruch eines gestrandeten Wals. Tagelang legt sich der Gestank über das Urlaubsressort – und wird so zum Sinnbild einer Beziehung, die längst nicht mehr zu retten ist. In seinem Debütroman Der Duft des Wals verwandelt Paul Ruban diese groteske Ausgangslage in eine moderne Parabel, die mit viel Fantasie an die biblische Geschichte des Propheten Jona erinnert.
Was zunächst makaber anmutet, entpuppt sich als schwarzhumorige Komödie. Gäste, die selbst am Pool Nasenklammern tragen, oder Drohnen, die den Duft von Chanel Nr. 5 verströmen, liefern Szenen, die man mit einem Schmunzeln liest. Gleichzeitig gelingt es Ruban, ernstere Untertöne anzuschlagen. Seine Umweltkritik bleibt dezent, ohne ins Didaktische zu kippen – ein Balanceakt, der dem Roman Leichtigkeit verleiht.
So ist Der Duft des Wals nicht nur ein Buch über die Tücken der Liebe, sondern auch über die Spuren, die Mensch und Tier in der Welt hinterlassen. Und: Es ist eine Lektüre, die man sich getrost am Strand vorstellen kann – trotz oder gerade wegen des penetranten Gestanks.
Sigrid Nunez: Die Verletzlichen (atb)
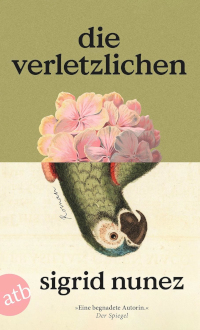
Eine Schriftstellerin mit Schreibblockaden, ein drogenabhängiger Schulabbrecher und ein sprechender Papagei namens Eureka: Aus dieser ungewöhnlichen Dreierkonstellation spinnt Sigrid Nunez in Die Verletzlichen ein feines Geflecht aus Nähe, Abhängigkeit und der Frage, was uns in Zeiten des Umbruchs trägt. Trotz Corona-Blues und existenzieller Schwere bleibt der Roman tröstlich – ein stilles Plädoyer für Mitgefühl und Verbundenheit.
Eureka ist dabei mehr als ein literarischer Kunstgriff: ein Wesen, das auf Hilfe angewiesen ist und doch Grenzen der Kommunikation überwindet – mit und ohne Worte. Durch ihn entschlüsselt Nunez kleine Gesten als große Antworten auf gesellschaftliche Fragen, ohne sie moralisch zu überhöhen. Der Papagei wird zum Spiegel menschlicher Verletzlichkeit, nicht zu ihrer Metapher. So gelingt Nunez ein leiser, kluger Roman über Fürsorge, Abhängigkeit und das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch und Tier.
Ramona Ausubel: The Last Animal (Riverhead Books/Penguin)
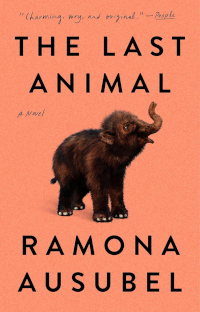
Die verwitwete Paläobiologin Janet bricht gemeinsam mit ihren Töchtern und einem Forschungsteam zu einer Expedition nach Sibirien auf. Dort hoffen sie auf den Fund des Jahrhunderts – und er ist ausgerechnet Janets Kindern zu verdanken: ein nahezu perfekt konserviertes Mammutbaby, das die Wissenschaft revolutionieren könnte. Rasch wird das urzeitliche Wesen zum Spielball der Eitelkeiten. Der Expeditionsleiter träumt davon, den Zellkern eines Mammuts in die Eizelle einer Elefantin zu injizieren und den daraus entstehenden Fötus in einen künstlichen Uterus im Labor zu verpflanzen – um eine verlorene Art zurück ins Leben zu rufen. Als ein Kollege Janets Forschungen für sich beansprucht, schlägt Begeisterung in Bitterkeit um. Getrieben von verletztem Stolz und wissenschaftlicher Hybris überschreitet sie die Grenze des moralisch Vertretbaren – und verbündet sich mit mit einer exzentrischen Britin, die in ihrem Zoo eine Elefantin hält und der Vision ebenfalls Gestalt verleihen möchte.
The Last Animal verbindet Science-Fiction mit Coming-of-Age-Erzählung und schlägt dabei unüberhörbar ökologische, leicht didaktische Töne an – zugleich ist der Roman eine pointierte Auseinandersetzung mit den patriarchalen Machtstrukturen in der Wissenschaft, den ethischen Fragen, die Geneditierung aufwirft, und der Traumaverarbeitung nach perönlichen Schicksalsschlägen.
R. L. Boyle: The Book of the Baku (Titan Books)
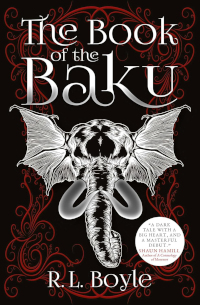
Die asiatische Mythologie wird von zahllosen Fabelwesen bevölkert: Der Baku, der seinen Ursprung in der chinesischen Tang-Dynastie hat und im Mittelalter vom japanischen Volksglauben übernommen wurde, ist keine Ausnahme. Einst ein Mischwesen aus Elefantenrüssel, Nashornaugen, Ochsenschwanz, Tigerpfoten und Löwenkopf, nimmt er in Japan im 19. Jahrhundert die Gestalt eines Malaiischen Tapirs an. Das Besondere an ihm? Er frisst die Alpträume von Kindern und schenkt ihnen so ruhigen Schlaf – sofern sie ihn in einem Ritual dreimal anrufen. Doch Vorsicht! Wer den Baku zu oft beschwört oder ihm keine „echten“ Alpträume bietet, nährt nur seinen Hunger – und muss ihn mit guten Träumen und Hoffnungen stillen. Ein Teufelskreis ohne Erwachen.
So ergeht es dem jungen, traumatisierten Sean in The Book of the Baku, der nach dem Tod seiner Mutter verstummt, an einem seltenen Gendefekt leidet und in die Obhut seines ihm fremden Großvaters kommt. Ein Schriftsteller, der die poetische Ader und das Interesse des 13-Jährigen an morbiden Themen fördert. Als Sean in der Gartenhütte auf eine alte Geschichte über den Baku stößt, muss er erkennen, dass seine Familie von einem unheimlichen Geheimnis verfolgt wird. Der Baku löst sich vom Papier und dringt in Seans Wirklichkeit ein. Die Grenze zwischen Traum und Realität beginnt zu zerfließen.
Für Liebhaber von Dark Fantasy und Young Adult Fiction à la Stranger Things oder The Shining ist diese Lektüre ein absolutes Muss.
Bei uns findest du noch viele weitere Buchtipps:

